Online-Angebote, die für Kinder und Jugendliche einer bestimmten Altersgruppe problematisch sind, müssen laut Gesetz mit technischen Vorkehrungen abgesichert sein.
Für entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte kommen folgende Maßnahmen infrage: Technische Kennzeichnungen, die von anerkannten Jugendschutzprogrammen ausgelesen und interpretiert werden können, technische oder sonstige Mittel, die Zugangshürden schaffen, oder Sendezeitbegrenzungen, die bestimmte Inhalte erst ab einer bestimmten Uhrzeit zugänglich machen – wie man es aus dem Fernsehen kennt. Relativ unzulässige Inhalte, z.B. Pornografie, dürfen nur in geschlossenen Benutzergruppen zugänglich sein: Mittels Identifizierung und Authentifizierung wird der Zugang auf Erwachsene beschränkt. Absolut unzulässige Inhalte dürfen generell nicht verbreitet werden.
Welche Inhalte angeboten bzw. wie Kinder und Jugendliche geschützt werden müssen, regelt der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag.
Technische Alterskennzeichnungen
Über ein technisches Label können entwicklungsbeeinträchtigende Angebote gesetzeskonform gestaltet werden.
Dafür ist bei Webinhalten u.a. die Datei age-de.xml erforderlich. Diese Datei enthält die Altersinformationen, die von Jugendschutzprogrammen ausgelesen werden können. Für die Nutzerinnen und Nutzer einer Website ist dieses Tagging nicht sichtbar. Auch einzelne Unterseiten und Bereiche einer Website oder eine komplette (Sub-)Domain können mit individuellen Altersstufen gekennzeichnet werden, so dass auch bei aktivierten Jugendschutzprogrammen die größtmögliche Verfügbarkeit von Angeboten besteht.
Mit einer Alterskennzeichnung nach age-de.xml Standard erfüllen Inhalteanbieter ihre gesetzliche Verpflichtung nach dem JMStV. Details sind in §§ 5 Abs. 3 S. 1 Nr. 1, 11 JMStV definiert.
Jugendschutzprogramme
Mit Jugendschutzprogrammen lassen sich je nach Altersstufe geeignete Internetangebote freischalten und ungeeignete blockieren.
Es handelt sich dabei um nutzerautonome Filter, die allein am Endgerät (PC, Tablet, Smartphone) bzw. im Heimnetzwerk (über den Router) oder als Teil des Internetzugangs aktiv sind. In der Regel bestehen die Programme aus Blocklists (Liste generell unzulässiger Websites), Passlists und einer umfangreichen Liste altersdifferenzierter Inhalte (zulässig je nach Einstellung der Altersstufe in der Software). Jugendschutzprogramme können zudem technische Alterskennzeichen auslesen, die dem gemeinsamen Standard (age-de.xml) entsprechen.
Daneben gibt es auch Jugendschutzprogramme für sogenannte geschlossene Systeme. Ein System ist z.B. dann geschlossen, wenn alle Inhalte innerhalb des Systems an herstellereigene Standards gebunden sind und das System in der Regel nicht ohne weiteres verlassen werden kann. Beispiele hierfür sind Video-on-Demand-Dienste oder Cloud-Gaming-Angebote.
Die FSM als anerkannte Selbstkontrolleinrichtung prüft und bewertet Jugendschutzprogramme seit 2016 anhand der gesetzlichen Grundlage (§ 11 Abs. 1 JMStV). Berücksichtigt werden dabei auch die von der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) erarbeiteten Kriterien.
Jugendschutzprogramme einfach erklärt
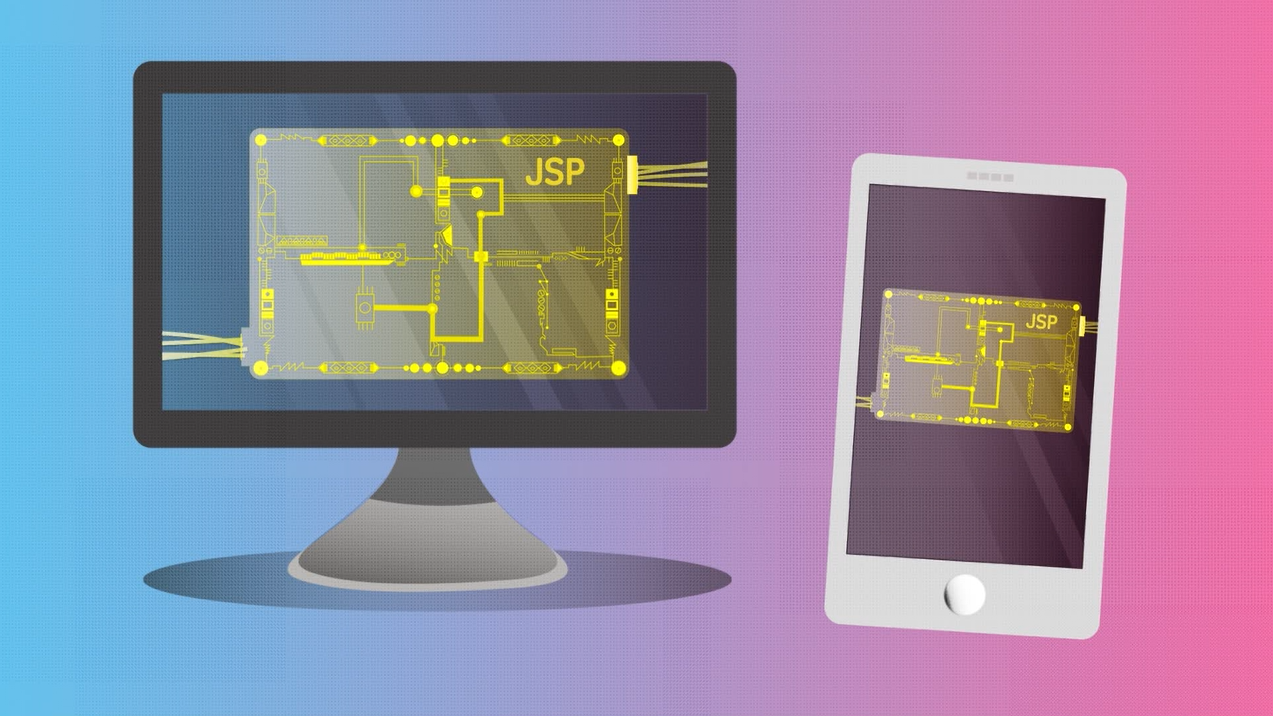
Welche anerkannten Jugendschutzprogramme gibt es?
Die FSM hat am 2. März 2017 nach Inkrafttreten des derzeit gültigen JMStV zum ersten Mal entschieden, die Software JusProg (Version 8.1.9) gemäß § 11 Abs. 1 JMStV als geeignetes Jugendschutzprogramm zu beurteilen. Die Entscheidung über die Eignung der Software war für die Dauer von zwei Jahren befristet. Am 1. März 2019 erhielt JusProg erneut eine positive Eignungsbeurteilung. Zuletzt hat die Gutachterkommission der FSM JusProg am 17. Januar 2022 getestet und entschieden, dass die neue Version 9.2.136 die gesetzlichen Anforderungen des § 11 Abs. 1 JMStV erfüllt.
JusProg ist eine Software für Windows ab Version 10. Es lässt sich abhängig vom Alter der Nutzerinnen und Nutzer auf die Altersstufen „ab 0/6/12/16/18 Jahre“ einstellen und bietet damit einen altersdifferenzierten Zugang zu Telemedien. Das Programm ist in der Lage, Alterskennzeichen nach § 5 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 JMStV auszulesen und verfügt über die Funktionalität, entwicklungsbeeinträchtigende und unzulässige Telemedienangebote zu erkennen und auszufiltern. Hierzu bedient es sich des BPjM-Moduls und einer eigenen altersdifferenzierten Liste.
Die Erkennungsleistung des Programms entspricht dem Stand der Technik, den der Gutachterausschuss vorab im Oktober 2021 ermittelt hat. Dies gilt sowohl für das Overblocking (eigentlich geeignete Angebote werden nicht angezeigt), als auch für das Underblocking (ungeeignete Angebote werden angezeigt). Die Software erfüllt die im Prüfzeitpunkt geltenden Anforderungen an Nutzerfreundlichkeit und einfache Bedienbarkeit, und es weist einen angemessenen Umgehungsschutz auf. JusProg ist zudem nutzerautonom verwendbar. Das bedeutet, Eltern können Websites für ihr Kind abweichend von den Voreinstellungen individuell freigeben oder sperren.
Die FSM hat am 16. August 2018, am 6. April 2020 und zuletzt am 20. Juli 2023 entschieden, dass die von Netflix vorgehaltene Schutzfunktion die Jugendschutz-PIN gemäß § 11 Abs. 2, 2. Alt. JMStV als geeignetes Jugendschutzprogramm innerhalb eines geschlossenen Systems zu beurteilen ist. Die Entscheidung über die Eignung der Jugendschutzfunktionen ist auf die Dauer von drei Jahren befristet. Netflix bietet in Deutschland ein Video-on-Demand-Angebot auf Abonnement-Basis an.
Bei den Jugendschutzfunktionen handelt es sich um ein Jugendschutzprogramm i.S.d. § 11 Abs. 2, 2. Alt. JMStV, da sie einen altersdifferenzierten Zugang zu Telemedien ausschließlich innerhalb eines geschlossenen Systems ermöglichen. Netflix verarbeitet formal die Altersstufen „ab 0/6/12/16/18 Jahre“ und erlaubt den Zugang zu Filmen und Serienfolgen aus einem Katalog, welcher vom Anbieter selbst bestückt wird. Auch ein Mobile-Games-Bereich zählt mittlerweile zum Netflix-Angebot.
Alle auf Netflix angebotenen Inhalte sind mit einem Alterskennzeichen versehen, welches innerhalb des Schutzsystems ausgelesen wird. Dadurch werden alle entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalte erkannt. Die Erkennungsleistung entspricht damit in jedem Fall dem Stand der Technik.
Zudem weist die Schutzfunktion einen angemessenen Umgehungsschutz auf. Zur Änderung bzw. Deaktivierung der Profilsperren oder der entsprechenden PIN ist das Accountpasswort einzugeben, welches jüngeren Familienmitgliedern regelmäßig nicht bekannt ist. Des Weiteren sind die Schutzfunktionen benutzerfreundlich und auch nutzerautonom verwendbar. Bei der erstmaligen Nutzung bzw. bei der Nutzung des Angebots mit dem zum Start verfügbaren Hauptprofil sind zunächst etwaige Altersbeschränkungen zu aktivieren. Für bereits eingerichtete Profile kann der Accountinhaber oder die Accountinhaberin die Aktivierung der einzelnen Schutzfunktionen in den Kontoeinstellungen („Konto“) im Browser oder auf einem mobilen Endgerät vornehmen. Die Hilfeseiten von Netflix erklären die Altersbeschränkungen ausführlich; dabei wird insbesondere auch auf die unterschiedlichen Wirkweisen und die gegenseitigen Ergänzungen von profilbezogenen Altersbeschränkungen und PIN-Sperre eingegangen, so dass durchschnittlich verständige Eltern die Vorteile beider Einzelfunktionen und die Effektivität ihrer Kombination einschätzen können.
Die FSM hat am 4. März 2020 entschieden, dass die für das Angebot Prime Video vorgehaltene Prime Video Kindersicherung gemäß § 11 Abs. 2, 2. Alt. JMStV als geeignetes Jugendschutzprogramm innerhalb eines geschlossenen Systems zu beurteilen ist. Am 15. März 2022 erhielt die Prime Video Kindersicherung erneut eine positive Eignungsbeurteilung.
Die innerhalb von Prime Video angebotenen Inhalte können von Nutzerinnen und Nutzern durch den Abschluss eines Abonnements, der Prime Mitgliedschaft (subscription-based video on demand, SVOD), oder durch entgeltliche Einmalausleihe und Käufe (transaction-based video on demand/electronic sell-through, TVOD/EST) abgerufen werden.
Bei der Prime Video Kindersicherung handelt es sich um ein Jugendschutzprogramm i.S.d. § 11 Abs. 2, 2. Alt. JMStV, da es einen altersdifferenzierten Zugang zu Telemedien ausschließlich innerhalb eines geschlossenen Systems ermöglicht. Die Prime Video Kindersicherung verarbeitet formal die Altersstufen „ab 0/6/12/16/18 Jahre“ und erlaubt den Zugang zu Filmen und Serienepisoden aus einem Katalog, welcher von der Antragstellerin selbst bestückt wird.
Sämtliche in Prime Video angebotenen Inhalte sind mit Alterskennzeichen i.S.d. § 5 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 JMStV versehen, welche innerhalb des Schutzsystems ausgelesen werden. Dadurch werden alle entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalte erkannt, weshalb die Erkennungsleistung in jedem Fall dem Stand der Technik entspricht.
Auch Funktionsfähigkeit und Umgehungssicherheit sind im hinreichenden Maße gegeben. Weder lässt sich die Schutzfunktion ohne die Eingabe des Amazon Account Passworts deaktivieren, noch ist die eingestellte Altersstufe ohne die Eltern PIN veränderbar. Die Jugendschutzfunktionen von Prime Video sind benutzerfreundlich ausgestaltet. Von jeder Seite der Benutzeroberfläche bedarf es maximal dreier Klicks bis zur Aktivierung der Kindersicherung. Darüber hinaus sind die Schutzfunktionen nutzerautonom verwendbar.
Die FSM hat am 19. Mai 2020 und zuletzt am 2. Juni 2023 entschieden, die für das Angebot von RTL+ Premium („ehemals TVNOW“) vorgehaltene Altersbeschränkung gemäß § 11 Abs. 2, 2. Alt. JMStV als geeignetes Jugendschutzprogramm innerhalb eines geschlossenen Systems zu beurteilen. Die Entscheidung über die Eignung der Jugendschutzfunktionen ist auf die Dauer von drei Jahren befristet. RTL bietet in Deutschland den Online-Service RTL+ als plattformübergreifendes Video-on-Demand-Portal an, das mittels Internetbrowser über die URL plus.rtl.de sowie über Apps auf Endgeräten mit den Betriebssystemen iOS, tvOS, Android und FireOS verfügbar ist.
Formal handelt es sich bei RTL+ um ein Jugendschutzprogramm i.S.d. § 11 Abs. 2, 2. Alt. JMStV, da es einen altersdifferenzierten Zugang zu Telemedien ausschließlich innerhalb eines geschlossenen Systems ermöglicht. RTL+ verarbeitet formal die Altersstufen „ab 0/6/12/16/18 Jahre“ und erlaubt den Zugang zu Einzelinhalten innerhalb des Angebots.
Alle auf RTL+ angebotenen Inhalte sind mit einem Alterskennzeichen i.S.d. § 5 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 JMStV versehen, welches innerhalb des Schutzsystems ausgelesen wird. Dadurch werden alle entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalte erkannt. Die Erkennungsleistung entspricht damit in jedem Fall dem Stand der Technik. Auch Funktionsfähigkeit und der Umgehungsschutz sind im hinreichendem Maße gegeben. Die Jugendschutzfunktionen von RTL+ Premium sind benutzerfreundlich ausgestaltet. Sie sind von jedem Ort innerhalb des Dienstes jeweils nur wenige Klicks bzw. Bedienschritte entfernt.
Die FSM hat am 24. August 2020 entschieden, dass die für das Angebot von MagentaGaming vorgehaltene Schutzfunktion in den Applikationen für Android, Windows und Mac gemäß § 11 Abs. 2, 2. Alt. JMStV als geeignetes Jugendschutzprogramm innerhalb eines geschlossenen Systems zu beurteilen ist. Die Entscheidung über die Eignung der Jugendschutzfunktionen ist auf die Dauer von drei Jahren befristet. Bei MagentaGaming (Laufzeit 2020 bis 2022) handelte es sich um eine cloudbasierte Gaming-Plattform, auf der MagentaGaming-Kundinnen und -Kunden dort hinterlegte Computerspiele von unterschiedlichen Publishern endgeräteunabhängig spielen können. Auf die Grundauswahl unterschiedlicher Spiele konnten MagentaGaming-Kundinnen und -Kunden im Rahmen eines Abonnements zugreifen.
Bei den Schutzfunktionen in MagentaGaming handelte es sich um ein Jugendschutzprogramm i.S.d. § 11 Abs. 2, 2. Alt. JMStV, da es einen altersdifferenzierten Zugang zu Telemedien ausschließlich innerhalb eines geschlossenen Systems ermöglicht. Die Jugendschutzfunktionen in MagentaGaming verarbeiteten formal die Altersstufen „ab 0/6/12/16/18 Jahre“ und erlaubten den Zugang zu Spielen aus einem Katalog, welcher von der Antragstellerin selbst bestückt wurde.
Sämtliche in MagentaGaming angebotenen Inhalte wurden mit Alterskennzeichen i.S.d. § 5 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 JMStV versehen, welche innerhalb des Schutzsystems ausgelesen wurden. Dadurch wurden alle entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalte erkannt, weshalb die Erkennungsleistung in jedem Fall dem Stand der Technik entsprach.
Auch die Funktionsfähigkeit und der Umgehungsschutz war in hinreichendem Maße gegeben. Zudem waren die Jugendschutzfunktionen von MagentaGaming benutzerfreundlich und auch nutzerautonom ausgestaltet. Von jedem Endgerät, auf dem eine MagentaGaming-Software lief, konnten die Jugendschutzfunktionen individuell konfiguriert werden. Von jeder Seite der Benutzeroberfläche bedurfte es maximal zweier Klicks bis zur Übersicht über die angelegten Spieler- und Spielerinnen-Profile und der jeweils aktivierten Schutzfunktionen und PIN-Aktivierungen.
Am 17. November 2020 hat die FSM entschieden, die Softwaretools JusProg für Android und JusProg für iOS als geeignete Jugendschutzprogramme gemäß § 11 Abs. 1 JMStV zu beurteilen. Die Entscheidung über die Eignung der Software ist für die Dauer von zwei Jahren befristet. Die Tools bieten einen altersdifferenzierten Zugang zu Telemedien und sind in der Lage Alterskennzeichen nach § 5 Abs. 3 S.1 Nr.1 JMStV auszulesen und entwicklungsbeeinträchtigende und unzulässige Telemedienangebote auszufiltern. Die Erkennungsleistung der Programme entspricht dabei dem Stand der Technik, wie er für den Prüfzeitpunkt September 2020 durch den Gutachterausschuss vorab ermittelt worden ist. Auch die die Funktionsfähigkeit und der Umgehungsschutz sind in hinreichendem Maße gegeben.
Zudem sind die Programme benutzerfreundlich ausgestaltet und nutzerautonom verwendbar. Sie lassen eine individuelle Auswahl der Altersstufe für den jeweiligen Nutzer oder die Nutzerin ebenso zu wie die Pflege persönlicher Passlists und Blocklists, die die programmseitig vorgegebenen Alterseinstufungen durch persönliche Einträge überstimmen.
Am 10. März 2021 hat die FSM entschieden, die im Rahmen von Disney+ vorgehaltene Funktion der „Altersfreigabe“ gemäß § 11 Abs.2, 2.Alt JMStV als geeignetes Jugendschutzprogramm innerhalb eines geschlossenen Systems zu beurteilen.
Disney+ bietet in Deutschland ein Video-on-Demand-Angebot auf Abonnement-Basis an. Für seine Profile kann der Accountinhaber oder die Accountinhaberin beim erstmaligen Anlegen oder im Rahmen der späteren Nutzung eine Altersbeschränkung aktivieren, so dass in dem jeweiligen Profil ausschließlich Einzeltitel angezeigt und abgespielt werden können, die der Alterseinstellung des Profils entsprechen.
Bei den Jugendschutzfunktionen handelt es sich dem Grunde nach um ein Jugendschutzprogramm i.S.d. § 11 Abs. 2, 2. Alt. JMStV handelt, da es einen altersdifferenzierten Zugang zu Telemedien ausschließlich innerhalb eines geschlossenen Systems ermöglicht. Disney+ verarbeitet formal die Altersstufen „ab 0/6/12/16/18 Jahre“ und alle auf Disney+ angebotenen Inhalte sind mit einem Alterskennzeichen i.S.d. § 5 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 JMStV versehen, welches innerhalb des Schutzsystems ausgelesen wird. Dadurch werden alle entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalte erkannt. Die Erkennungsleistung entspricht damit in jedem Fall dem Stand der Technik. Zudem weist die Schutzfunktion einen angemessenen Umgehungsschutz auf. Funktionsfähigkeit, Benutzerfreundlichkeit und nutzerautonome Verwendbarkeit sind auch gegeben. Insgesamt ist für die Konfiguration eines sicheren altersbeschränkten Profils inklusive eines vollständigen Umgehungsschutzes die Vornahme von drei Einstellungen an bis zu drei verschiedenen Stellen der Konfiguration durch die Eltern nötig. Sie müssen die Altersbeschränkung eines Profils aktivieren, höher eingestellte andere Profile mit einer PIN absichern und das Neuanlegen von Profilen in der Konfiguration des Elternaccounts deaktivieren. Insgesamt ist die Vornahme dieser Einstellungen für den durchschnittlichen Nutzer und die durchschnittliche Nutzerin machbar. Der Hauptnutzer oder die Hauptnutzerin kann die Altersbeschränkung in den Einstellungen der einzelnen Profile jederzeit ändern und so an den Entwicklungsstand seines bzw. ihres Kindes anpassen.
Die FSM-Gutachterkommission ist in ihrer Entscheidung vom 5. November 2021 zu dem Ergebnis gekommen, dass die von der Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG im Rahmen von WOW (ehemals „Sky Ticket“) vorgehaltene Schutzfunktion der Jugendschutz-PIN als ein gemäß § 11 Abs. 2, 2. Alt. JMStV geeignetes Jugendschutzprogramm innerhalb eines geschlossenen Systems zu beurteilen ist.
Das System erfüllt die gesetzlichen Vorgaben des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags und steht im Einklang mit den Verhaltenskodizes der FSM, so dass es das FSM-Prüfsiegel erhält.
Die Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG bietet mit „WOW“ in Deutschland ein Video-Angebot auf Abonnement-Basis an. Im Rahmen der unterschiedlichen Abonnements erhalten die Kunden und Kundinnen Zugang zu Video-on-Demand-Inhalten sowie teilweise zu Live-Programmen. Ein Abruf der Inhalte ist über PC-Browser, Smartphones und Tablets, Streaming-Sticks, Smart-TVs und Konsolen möglich. Dabei bietet WOW den Abonnenten und Abonnentinnen eine Schutzfunktionalität mittels Einrichtung einer vierstelligen Jugendschutz-PIN an, die das Wahrnehmen von nicht altersgemäßen Inhalten des Angebots durch minderjährige Nutzerinnen und Nutzer unterbinden sollen.
Die Aktivierung der Schutzfunktion sowie die Einstellung der zu schützenden Altersstufen kann die Accountinhaberin oder der Accountinhaber während des Registrierungsprozesses und danach jederzeit und für alle genutzten Endgeräte in seinen Nutzereinstellungen vornehmen und ändern. Wurde im Account eine Altersbeschränkung aktiviert, muss die Jugendschutz-PIN beim Abruf von non-linearen sowie linearen Inhalten mit der ausgewählten Alterseinstufung und allen höheren zwingend eingegeben werden.
Sämtliche in WOW angebotenen Inhalte sind mit Alterskennzeichen i.S.d. § 5 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 JMStV (Altersstufen „ab 0/6/12/16/18 Jahre“) versehen, die die Schutzfunktion ausliest. Dadurch werden sämtliche entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte erkannt, weshalb die Erkennungsleistung in jedem Fall dem Stand der Technik entspricht. Die Funktionsfähigkeit und der Umgehungsschutz sind in hinreichendem Maße gegeben. Zudem sind die Jugendschutzfunktionen von WOW benutzerfreundlich und nutzerautonom ausgestaltet.
Datenschutz-, vertrags-, urheber- und wettbewerbsrechtliche Bewertungen sind nicht in die Prüfung eingegangen.
Am 8. Juni 2022 hat die FSM entschieden, die im Rahmen von GigaTV (über GigaTV Box 2) vorgehaltene Funktion der Jugendschutz-PIN gemäß § 11 Abs. 2, 2. Alt JMStV als geeignetes Jugendschutzprogramm innerhalb eines geschlossenen Systems zu beurteilen.
Die Vodafone GmbH bietet in Deutschland das Video-Angebot „GigaTV“ auf Abonnement-Basis für Kundinnen und Kunden an, die über ein Vodafone Kabelanschluss verfügen. Über die im Abonnement enthaltene GigaTV Box 2 sowie die passende mobile GigaTV-App für iOS und Android ermöglicht die Anbieterin ihren Kundinnen und Kunden den Zugang zu Video-on-Demand-Inhalten sowie zu Live-TV-Programmen (im Folgenden: GigaTV). Ein Abruf der Inhalte ist ausschließlich über die GigaTV Box 2 sowie die App möglich. Vodafone ermöglicht ihren Abonnentinnen und Abonnenten, den eigenen Kundenaccount mit einer Altersbeschränkung zu versehen, die den Zugang zu nicht altersangemessenen Einzeltiteln und Sendungen von der Eingabe einer vierstelligen PIN abhängig macht. Diese Jugendschutz-PIN wird neuen Kundinnen und Kunden nach Abschluss eines Abos zusammen mit den Login-Daten für GigaTV auf dem Postweg zugeschickt.
Bei dieser Jugendschutzfunktion handelt es sich dem Grunde nach um ein Jugendschutzprogramm i.S.d. § 11 Abs. 2, 2. Alt. JMStV, da es einen altersdifferenzierten Zugang zu Telemedien ausschließlich innerhalb eines geschlossenen Systems ermöglicht. GigaTV verarbeitet formal die Altersstufen „ab 0/6/12/16/18 Jahre“ und alle auf GigaTV angebotenen Inhalte sind mit einem Alterskennzeichen i.S.d. § 5 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 JMStV versehen, welches innerhalb des Schutzsystems ausgelesen wird. Dadurch werden alle entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalte erkannt. Die Erkennungsleistung entspricht damit in jedem Fall dem Stand der Technik. Zudem weist die Schutzfunktion einen angemessenen Umgehungsschutz auf. Funktionsfähigkeit, Benutzerfreundlichkeit und nutzerautonome Verwendbarkeit sind auch gegeben. Die Aktivierung der Jugendschutz-PIN erfolgt durch das Anwählen der jeweiligen Altersstufe und erfüllt die Anforderungen an eine einfache Aktivierung. Die Hilfeseiten von Vodafone erklären die PIN-basierte Altersbeschränkung ausführlich. Dabei wird auch auf die Möglichkeiten der Alterseinstellung und einer ggf. erwünschten Reaktivierung eingegangen. Durchschnittlich verständige Eltern können die Funktionsweise der Jugendschutz-PIN und die angebotenen Einstellungsoptionen in ihrer Bedeutung einordnen und entsprechend bedienen. Im Fall von Problemen finden sie unkompliziert zugänglich weitere Erläuterungen.
Die FSM hat am 24. November 2022 entschieden, die für das Angebot von Paramount+ vorgehaltenen Funktionen der accountweiten Altersbeschränkung mit PIN-Schutz sowie der Einrichtung von Kinderprofilen (Kinder-Modus) gemäß § 11 Abs. 2, 2. Alt. JMStV als geeignetes Jugendschutzprogramm innerhalb eines geschlossenen Systems zu beurteilen. Die Entscheidung über die Eignung der Jugendschutzfunktionen ist auf die Dauer von drei Jahren befristet.
Die VIMN Germany GmbH bietet in Deutschland den Video-on-Demand-Dienst Paramount+ auf Abonnement-Basis an. Im Rahmen des Abonnements ermöglicht die Anbieterin ihren Kundinnen und Kunden den Zugang zu Video-on-Demand-Inhalten. Ein Abruf der Inhalte ist über PC-Browser, Smartphones und Tablets, Streaming-Sticks, Smart-TVs und Konsolen möglich.
Formal und dem Grunde nach handelt es sich bei Paramount+ um ein Jugendschutzprogramm i.S.d. § 11 Abs. 2, 2. Alt. JMStV, das einen altersdifferenzierten Zugang zu Telemedien ausschließlich innerhalb eines geschlossenen Systems ermöglicht. Paramount+ verarbeitet innerhalb der Schutzfunktionen formal die Altersstufen „0/6/12/16/18 Jahre“ und erlaubt den Zugang zu Inhalten, die ausschließlich Paramount+ selbst zur Verfügung stellt.
Sämtliche zugänglich gemachten Inhalte im Rahmen des geschlossenen Systems sind altersgekennzeichnet. Da diese Kennzeichnungen zuverlässig technisch ausgelesen und in entsprechende Sperren umgesetzt werden, liegt die Erkennungsleistung der Schutzfunktion bei 100 Prozent. Damit entspricht sie in jedem Fall dem Stand der Technik.
Auch Funktionsfähigkeit und Umgehungsschutz sind in hinreichendem Maße gegeben, die Jugendschutzfunktionen von Paramount+ sind benutzerfreundlich ausgestaltet. Dies gilt sowohl für die accountweite, d.h. profilübergreifende Altersbeschränkung (Altersstufen 6/12/16/18), die mit einer PIN abgesichert ist, sowie für den profilbasierten Kinder-Modus (Altersstufen 0/6 und 0/6/12).
Anforderungen an Jugendschutzprogramme gemäß JMStV sind z.B.
- Zugang zu Inhalten differenziert nach Altersstufen ermöglichen
- Alterskennzeichnungen von Internetangeboten auslesen
- Entwicklungsbeeinträchtigende Angebote entsprechend dem Stand der Technik erkennen
Weitere technische Zugangshürden
Um Heranwachsende vor entwicklungsbeeinträchtigenden Angeboten zu schützen, können z.B. technische Mittel genutzt werden.
Diese Zugangshürden müssen Nutzerinnen und Nutzer überwinden, um auf die entsprechenden Inhalte zuzugreifen. Der JMStV gibt hier keine weiteren konkreten Vorgaben, sondern beschränkt sich auf die Festlegung des Schutzniveaus. Danach muss Kindern und Jugendlichen die Wahrnehmung der Inhalte unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden.
In der Praxis haben sich dafür
unterschiedliche Ansätze etabliert:
- Eingabe einer PIN
- Qualifiziertes Abfragen der Personalausweisdaten
- Altersüberprüfung per Webcam
Sendezeit beschränken
Auch durch das Setzen von Zeitgrenzen lassen sich entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte gesetzeskonform anbieten.
Dabei gilt, dass Inhalte „ab 18 Jahren“ ab 23 Uhr und Inhalte „ab 16 Jahren“ ab 22 Uhr angeboten werden können. Diese aus dem Fernsehen bekannte Maßnahme eignet sich auch für den Online-Bereich, z.B. bei Mediatheken. Bei Inhalten „ab 12 Jahren“ sieht das Gesetz vor, dass die Sendezeit mit Blick auf das Wohl jüngerer Kinder gewählt wird. Online gilt zudem: Inhalte, die für Unter-14-Jährige ungeeignet sind, dürfen nur getrennt von reinen Kinderangeboten zugänglich sein.

Altersverifikationssysteme
Mit einem Altersverifikationssystem dürfen Anbieter relativ unzulässige Online-Inhalte (z.B. Pornografie) Erwachsenen nach einer Identifizierung sowie Authentifizierung zugänglich machen.
Mit der Identifizierung wird die Volljährigkeit der Nutzerinnen und Nutzer geprüft. Sicher feststellen lässt sich das nur durch einen persönlichen Kontakt („Face-to-Face-Kontrolle“). Eine rein technische Altersverifikation ist jedoch dann denkbar, wenn sie die hohe Zuverlässigkeit einer persönlichen Altersprüfung erreicht.
Neben der einmaligen Identifizierung ist die Authentifizierung bei jedem Nutzungsvorgang notwendig: Es muss gewährleistet sein, dass nur diejenige Person die entsprechenden Inhalte abrufen kann, die zuvor als volljährig identifiziert wurde. Zudem soll das Risiko einer Weitergabe von Zugangsdaten an Minderjährige reduziert werden.
Ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist stets eine Frage des Einzelfalls. Bei Verstößen können die Landesmedienanstalten durch die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) Sanktionen gegen den jeweiligen Anbieter verhängen.
Die FSM hat für ihre Mitgliedsunternehmen zahlreiche Altersverifikationssysteme geprüft und zertifiziert. Die mit einem FSM-Prüfsiegel versehenen Systeme finden Sie hier.
Die KJM hat hier eine Liste mit von ihr bewerteten Altersverifikationssystemen veröffentlicht.
Datenschutz bei Kinderangeboten
Online-Angebote für Kinder, ob Websites, Apps oder andere digitale Angebote, unterliegen besonderen Anforderungen an den Datenschutz.
Denn Kinder und Jugendliche sind sich der Risiken im Internet oft weniger bewusst als Erwachsene. In der Regel dürfen personenbezogene Daten nur nach der Einwilligung der Nutzerinnen und Nutzer verarbeitet werden. Bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren müssen ihre Eltern diese Einwilligung erteilen, ansonsten ist eine Datenverarbeitung nicht rechtmäßig. Mehr zu den Anforderungen an den Datenschutz bei Kinderangeboten und wie diese in der Praxis umgesetzt werden können, finden Sie in dieser Broschüre.
